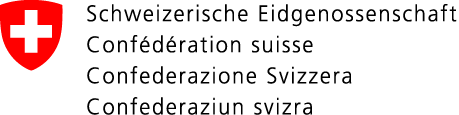Frau Bundesrätin, in Schaffhausen sprechen Sie zum Thema "Zuwanderung – Risiko oder Chance?". Was ist die grösste Herausforderung, die bei der Zuwanderung auf die Schweiz zukommt?
Die grösste Herausforderung ist, die hohe Lebensqualität in unserem Land zu halten. Die hohe Lebensqualität und den wirtschaftlichen Wohlstand verdanken wir auch der Zuwanderung. Wenn die Bevölkerung wächst, dann müssen wir uns noch stärker bemühen, die Landschaften zu schützen, für zahlbaren Wohnraum zu sorgen und die guten Arbeitsbedingungen zu erhalten. Diese Aufgaben müssen wir sowieso angehen. Mit dem Bevölkerungswachstum aber wächst der Druck, diese Herausforderungen wirklich anzupacken.
Letzte Woche haben Sie gleich im Dreierteam den Abstimmungskampf zur Masseneinwanderungs-Initiative eröffnet. So viel Repräsentanz erfordert eine Erklärung.
Ich gebe Ihnen sogar zwei: Erstens trat der Bundesrat bei allen Abstimmungen zur Personenfreizügigkeit zu dritt auf. Denn es geht auch um wirtschaftliche und aussenpolitische Fragen. Zweitens geht es in dieser Abstimmung in der Tat um sehr viel. Es geht darum, ob wir in Zukunft mit oder ohne Personenfreizügigkeit weiterarbeiten wollen. Wollen wir den bilateralen Weg weiterverfolgen oder nicht?
An der Pressekonferenz bemühten Sie sich, nicht zu drohen. Die Guillotine-Klausel – bei der das ganze Paket der Bilateralen gekündigt werden müsste, sobald nur ein Teil davon nicht bestätigt wird – erwähnten Sie erst auf Nachfrage von Journalisten. War das Taktik, weil noch gar nicht sicher ist, ob die EU die Bilateralen mit der Schweiz nach einer Annahme der Initiative wirklich kündigen würde?
Ich drohe nicht. Das ist nicht meine Art, Politik zu machen. Ich informiere. Die Stimmbürger sollen ihre Entscheidungen aufgrund von sachlichen Informationen fällen.
Nochmals: Die EU ist auch an bilateralen Verträgen mit der Schweiz interessiert.
Genau. Ich weise lediglich darauf hin, was heute im Vertrag steht, und beschreibe die rechtliche Ausgangslage. Was nach einer allfälligen Annahme passieren könnte, ist Spekulation.
Wie lange noch kann die Schweiz gut 70 000 Zuwanderer pro Jahr aufnehmen?
Die Zuwanderung der letzten Jahre ist Ausdruck davon, dass unsere Wirtschaft blüht. Erinnern wir uns an die 90er-Jahre, da hatten wir null Wachstum, eine hohe Arbeitslosigkeit – und keine Zuwanderung. Die Zuwanderung ist immer dann hoch, wenn es der Wirtschaft gut geht. Das war auch unter dem Kontingentsystem nicht anders. Zu diesem System wollen die Initianten jetzt ja wieder zurück. Doch: Wie viele Personen zuwandern, hängt nicht vom Modell ab, sondern davon, ob es der Wirtschaft gut geht.
Die Zuwanderung hat auch Schattenseiten. Zugewanderte etwa arbeiten meist für weniger Lohn als Schweizer. Das führt laut Befürwortern dazu, dass das Lohnniveau für alle sinkt. Was tun Sie dagegen?
Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Behauptungen der Initianten übernehmen. In dieser Abstimmung ist es ganz wichtig, dass die Bevölkerung die Fakten erfährt. Fakt ist, dass das Lohnniveau mit der Personenfreizügigkeit nicht gesunken ist. Die flankierenden Massnahmen, über die wir ebenfalls abgestimmt haben und die auch immer wieder überprüft werden, sind absolut zentral. Wir wollen nicht, dass die Zuwanderung dazu führt, dass sich unsere Arbeitsbedingungen verschlechtern.
Der "Fall HB", bei dem die Unia Lohndumping aufdeckte, hat unlängst gezeigt, dass noch lange nicht alles im grünen Bereich ist.
Und deshalb ist es so wichtig, dass der Bundesrat und die Kantone bei Missbrauch hart durchgreifen. Die Kantone verstärken die Kontrollen und schauen genau hin. Und der Bundesrat hat gerade mit der Solidarhaftung letztes Jahr gezeigt, dass er gesetzliche Bestimmungen bei Bedarf auch verschärft.
Wie erklären Sie denn den Bürgern, die sich über die Zuwanderung beklagen, inwiefern sie von ebendieser profitieren?
Stellen wir uns vor, wie es uns gehen würde, hätten wir keine Zuwanderung. Als Beispiel dient Irland, das noch vor Kurzem eine blühende Wirtschaftsnation war. Seit der Finanzkrise ist die dortige Wirtschaft am Boden. Spannend ist nun: Gleichzeitig wurde Irland von einem Einwanderungsland zu einem Auswanderungsland. Zuwanderung ist also immer Ausdruck einer starken Wirtschaft. Das war schon in den 60er-Jahren so, als der Wirtschaftsmotor brummte und die Zuwanderung hoch war. Dann kam Anfang der 70er-Jahre die Ölkrise, und mit ihr blieb die Zuwanderung aus. Dieser Zusammenhang gilt nicht nur für die Schweiz, sondern auch für andere Staaten. Kontingente mit tiefer Zuwanderung gleichzusetzen, ist also falsch. Kümmern wir uns stattdessen um die realen Probleme: Dort, wo die Zuwanderung tatsächlich Auswirkungen hat, haben wir es in der Hand, diesen entgegenzuwirken. Wir entscheiden selbst, wo gebaut wird. Wir stoppen die Zersiedelung selbst. Wir sorgen selbst für zahlbaren Wohnraum. Wir schauen, dass die Arbeitsbedingungen gut bleiben.
Nur: Je mehr Leute in der Schweiz leben, desto schneller wird es eng hier.
Diese Überlegungen nehme ich sehr ernst. Auch hier lohnt es sich, genau hinzuschauen, warum unsere Züge voll und unsere Strassen manchmal verstopft sind. Die Schweizer pendeln jedes Jahr mehr und jedes Jahr weiter. Wir beanspruchen immer mehr Wohnraum, es gibt in unserem Land heute so viele Einpersonenhaushalte wie nie zuvor. Diese Entwicklungen haben keinen Zusammenhang mit der Zuwanderung – aber das Bevölkerungswachstum verstärkt den Trend. Keine Zuwanderung mehr zuzulassen, wäre auch keine Lösung. Die Masseneinwanderungs-Initiative löst kein einziges dieser Probleme. Genau das sollten wir aber tun: unsere Probleme lösen. Etwa, indem wir am 9. Februar an der Urne einen verkehrspolitischen Meilenstein annehmen, nämlich "Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur Fabi".
Die Initiative will ja nicht keine Zuwanderung mehr, sondern eine Begrenzung durch Kontingente.
Richtig. Die Initiative will zu einem Modell zurückkehren, das wir in den 60er-Jahren bereits einmal hatten, und damals hatten wir mehr Zuwanderung als heute. Es stimmt also nicht, dass wir mit dieser Initiative automatisch weniger Zuwanderung hätten. Hingegen würde diese Initiative enorme Bürokratie verursachen – insbesondere für die KMU, das Rückgrat unserer Wirtschaft. Weiss das einzelne Unternehmen jedes Jahr nicht, ob es noch Angestellte findet, bedeutet dies das Ende der Planungssicherheit. Die Folge wäre eine enorme Schwächung der Wirtschaft.
Themenwechsel: Bei der Durchsetzungs- und bei der Abzocker-Initiative sind die Initianten mit der Umsetzung unzufrieden. Überspannt der Bundesrat bei der Umsetzung von Volksinitiativen momentan nicht etwas den Bogen?
Heute gehört es zur Politik, dass die Initianten ob der Umsetzung des Bundesrates bei ihren Initiativen unzufrieden sind. Der Bundesrat nimmt Abstimmungsergebnisse und damit die Entscheidungen der Stimmbürger sehr ernst. Aber: Steht zum Beispiel ein Initiativtext im Widerspruch zu anderen Artikeln der Bundesverfassung, muss der Bundesrat eine Lösung finden. Denn die geltende Bundesverfassung wurde ja ebenfalls von den Stimmbürgern beschlossen. Wenn der Bundesrat solche Widersprüche umsetzen muss, kann er es also gar nicht allen recht machen.
Ständerat Minder will die Enttäuschten an einen Tisch holen, um darüber zu diskutieren, wie verhindert werden kann, dass der Bundesrat Volksinitiativen nach seinem Gusto umsetzt. Wären Sie zu solchen Verhandlungen bereit?
Von diesem Tisch für Enttäuschte habe ich bis jetzt noch nie gehört und wurde auch noch nie darauf angesprochen. In unserer Demokratie haben Bundesrat und Parlament nicht die gleichen Rollen. Das ist auch gut so. Wer mich aber kennt, weiss, dass ich grundsätzlich immer gesprächsbereit bin.
Im September haben Sie einen erleichterten Familiennachzug für in der Schweiz lebende Syrer beschlossen. Am Freitag haben Sie diese Erleichterungen wieder aufgehoben. Warum der Wandel?
Die Schweiz hat mit dieser Massnahme sehr vielen syrischen Familien rasch und unbürokratisch geholfen. Das ist das Wichtigste in dieser Situation. Es war von Anfang an klar, dass es sich um eine vorübergehende Massnahme handelt. Diese Weisung habe ich wieder aufgehoben, weil man davon ausgehen kann, dass die meisten Familienangehörigen in Not in diesen fast drei Monaten die Gelegenheit nutzen konnten, unter erleichterten Bedingungen ein Visum zu beantragen. Selbstverständlich müssen wir aber weiterhin vor Ort helfen, was die Schweiz mit über 50 Millionen Franken auch macht. Die Schweiz wird diese Menschen in Not weiterhin unterstützen.
Hat die Aufhebung der Visaerleichterungen damit zu tun, dass so viele Syrer davon Gebrauch machten?
Nein. Wir haben von Anfang an mit einer grossen Bandbreite gerechnet. Das Wichtigste ist, dass wir mit dieser Massnahme vielen kriegsbetroffenen Menschen helfen konnten.
Letzte Änderung 03.12.2013