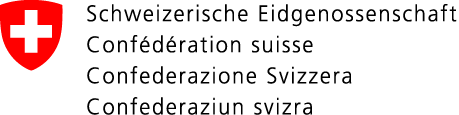Frau Bundesrätin, am 9. Februar stimmen wir über die SVP-Masseneinwanderungsinitiative ab. Bald danach stehen auch noch die Urnengänge über die ähnlich gelagerte Ecopop-Initiative sowie – voraussichtlich – über die Ausweitung der Personenfreizügigkeit auf Kroatien an. Ist diese Häufung der Zuwanderungsvorlagen gut oder schlecht?
Ich finde das sehr gut. Die Zuwanderung ist ein wichtiges Thema, das die Menschen beschäftigt. Die Diskussionen zeigen, dass die Migrationspolitik eng mit Wirtschaftspolitik, mit Entwicklungszusammenarbeit, mit Aussenpolitik und mit Integration zusammenhängt – es geht also um ein breites Feld von politischen Fragen, und es ist gut, darüber zu diskutieren.
Gleichzeitig habe ich auch grossen Respekt vor diesen Abstimmungen. Gerade bei der Masseneinwanderungsinitiative steht viel auf dem Spiel. Es geht um eine grundsätzliche Frage: Wollen wir einen Systemwechsel, weg von der Personenfreizügigkeit, zurück zum früheren System der Kontingente? Mit dieser Frage müssen sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger intensiv auseinandersetzen, denn ihr Entscheid hat wesentliche Folgen für unser Land.
Ist dem wirklich so? Die Initiative setzt ja keine Höchstzahlen für die Zuwanderung. Also könnte man die Kontingente doch einfach so hoch ansetzen, dass alle – Wirtschaft und EU – zufrieden sind?
Es stimmt – die Initianten haben keine Zahlen festgelegt. Deshalb könnte es sogar sein, dass nach Einführung der Kontingente die Zuwanderung sogar noch höher ist als jetzt. Wenn man also sagt, mit einem Ja zur Initiative hätten wir automatisch eine tiefe Zuwanderung, dann ist das unredlich. Das zeigt auch ein Blick in die Geschichte: In den 1960er Jahren, als man mit Kontingenten arbeitete, war die jährliche Zuwanderung deutlich höher als heute.
Fakt ist: Wenn die Konjunktur läuft und es uns gut geht, ist die Zuwanderung gross, wenn es schlecht geht, geht auch die Zuwanderung zurück. Und das unabhängig vom Zuwanderungsmodell, also Personenfreizügigkeit oder Kontingente.
Wenn also die Initiative ohnehin die Zuwanderung nicht sicher begrenzen kann – weshalb braucht es dann aus Ihrer Sicht ein Nein?
Wenn man Zuwanderung mit Kontingenten lösen will, entsteht eine Riesenbürokratie. In der Initiative steht nicht einmal, wer die Zahlen festlegen soll. Der Bundesrat? Die Bundesversammlung? Und wer definiert die "gesamtwirtschaftlichen Interessen", von denen im Initiativtext die Rede ist? Die Banken, die Pharmaindustrie, der Tourismus, die Bauern? Die Kontingente und die Verteilung müssten Jahr für Jahr neu ausgehandelt werden – und das ist gerade für die kleinen und mittleren Unternehmen, die auf Planungssicherheit angewiesen sind, schwierig. Das ist der grosse Nachteil der Initiative – nebst dem, dass das Kontingentsystem mit der Personenfreizügigkeit unvereinbar ist und man so mit einer der Grundfreiheiten der EU in Konflikt geriete.
Aber ist es denn wirklich ein zugkräftiges Argument, dass nach einem Ja die bilateralen Verträge in Gefahr sind? Zwanzig Jahre nach dem EWR-Nein müssen auch die damaligen Befürworter eingestehen, dass die Folgen nicht allzu gravierend waren.
Der Bundesrat hat die Pflicht, die Bevölkerung über mögliche Folgen zu informieren. Nach einem Ja würde der Bundesrat sicher das Gespräch mit der EU suchen. Käme es danach aber zu einer Kündigung der Personenfreizügigkeit, würden innerhalb von sechs Monaten auch die restlichen Bilateralen-I-Verträge automatisch hinfällig.
Nochmals: Wäre das wirklich so schlimm?
Mit den bilateralen Verträgen sichern wir uns den Marktzugang in die EU. Diese ist unsere wichtigste Handelspartnerin mit einer täglichen Handelsbilanz von rund einer Milliarde Franken. Ob die EU ausgerechnet in der Personenfreizügigkeit für die Schweiz eine Sonderregelung akzeptieren würde, ist unsicher. Es müssten alle 28 EU-Staaten einzeln dieser Ausnahme zustimmen, und zwar in einem Kernbereich der EU. Wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit, dass alle EU-Staaten der Schweiz eine solche Ausnahme zugestehen würden?
Gerade bei Zuwanderungsvorlagen spielen solche rationalen Argumente oft keine Rolle – vielmehr wird ein Bauchgefühl zum Ausdruck gebracht, ein Unbehagen gegenüber allem Fremden. Ich habe oft den Eindruck, dass gerade linke Parteien solche Ängste manchmal herunterspielen, um nicht ins Fahrwasser der SVP-Rhetorik zu gelangen.
Es geht nicht um Rhetorik, sondern darum, was die Menschen beschäftigt. Ich nehme auch Bauchgefühle sehr ernst – Gott sei Dank besteht der Mensch nicht nur aus Kopf, sondern auch aus Bauch. Solche Ängste gab es übrigens schon immer: Wenn Veränderungen rasch erfolgen, wenn die Bevölkerung rasch wächst, dann macht das die Leute stutzig. Dahinter steht letztlich die Frage, wie wir die hohe Lebensqualität in unserem Land erhalten können. Was müssen wir tun, damit das Wachstum nicht auf Kosten dieser Lebensqualität geht? Es braucht eine Vielzahl von Massnahmen: Die Städte sind gefordert, damit Wohnraum bezahlbar bleibt, die Kantone, wenn es um den Landschaftsschutz geht, die Sozialpartner, damit die guten Arbeitsbedingungen erhalten bleiben. Die Initiative löst kein einziges dieser Probleme.
Um beim Bauchgefühl zu bleiben: Was sind denn aus Ihrer Sicht die grössten Zerrbilder und Irrtümer im Bereich der Zuwanderung?
Es ist manchmal erstaunlich, zu welchen Erkenntnissen man kommt, wenn man einfach einmal die Zahlen betrachtet: So wird beispielsweise derart häufig über Asylsuchende geschrieben, dass man denkt, das sei ein Riesenthema in der Schweiz. Die Asylsuchenden machen jedoch lediglich 0,5 Prozent der Bevölkerung aus. Auch die Zahlen über die Zuwanderung können überraschen: Über sechzig Prozent der Angestellten in der Landwirtschaft oder auf dem Bau sind Ausländer, in den Spitälern ist es jede dritte Person. Das heisst: Ganze Branchen würden ohne Zuwanderung kaum mehr funktionieren.
Seit einiger Zeit kehren gerade Deutsche wieder vermehrt in ihr Heimatland zurück. Sehen Sie das als Zeichen der Entspannung – oder sorgen Sie sich bereits wieder um die hiesige Wirtschaft?
Dies zeigt einfach, dass sich die Zuwanderung sehr schnell ändern kann. Nehmen Sie das Beispiel Irland: 2007 blühte dort die Wirtschaft, die Arbeitslosigkeit betrug 4 Prozent, Irland war ein attraktives Einwanderungsland. Heute, nach der Finanzkrise, beträgt die Arbeitslosigkeit 12,5 Prozent, und Irland ist zum Auswanderungsland geworden. Die Zuwanderung ist eben in erster Linie Ausdruck einer guten Konjunktur.
Hierzulande machen bereits Szenarien einer "Zehn-Millionen-Schweiz", gar einer "Elf-Millionen-Schweiz" die Runde. Wie viele Menschen verträgt die Schweiz?
Lebensqualität hängt nicht von einer fixen Zahl ab, sondern davon, ob wir uns in diesem Land wohl fühlen. Und hier ist zum Bespiel gerade die Integration ein wichtiger Aspekt – dass es Regeln gibt, wie man zusammenlebt, gerade auch wenn sich Menschen aus unterschiedlichen Kulturen im Land aufhalten. Wichtig sind auch gute Arbeitsbedingungen, wie wir sie mit den Flankierenden Massnahmen und einer gut funktionierenden Sozialpartnerschaft sichern.
Gibt es denn einen eigentlichen "Königsweg", um die Zuwanderung in einer Balance zu halten zwischen den Ansprüchen der Wirtschaft, einer humanitären Grundhaltung, den politischen Verpflichtungen, der Stimmung in der Bevölkerung und dem, was das Land vertragen kann?
Es gibt diese Spannungsfelder, diese widersprüchlichen Interessen – wie kann man der Wirtschaft gerecht werden, eine offene Schweiz beibehalten und trotzdem dafür sorgen, dass sich die Leute im Land sicher und wohl fühlen? Darum ist es so wichtig, dass wir über Lebensqualität reden. Diese hat nicht nur mit Wohlstand, sondern zum Beispiel auch mit der Landschaft zu tun. Die Bevölkerung hat mit ihren beiden Ja zur Zweitwohnungsinitiative und zum Raumplanungsgesetz deutlich gemacht, dass sie die Landschaft als etwas Wichtiges und Schützenswertes betrachtet. Wir haben es in der Hand, die Zukunft unseres Landes zu gestalten. Und dies ganz unabhängig von der Frage der Zuwanderung.
Wenn Sie in der Öffentlichkeit stehen, geht es oft um die Themen Zuwanderung, Ausländer oder Asyl. Wird man Ihrer Arbeit gerecht, wenn man Sie als "Migrationsministerin" bezeichnet?
Es freut mich, wenn man mich als aktive und engagierte Migrationsministerin sieht. Es ist nun mal ein zentrales Thema und eines, das die Menschen bewegt. Aber natürlich habe ich in meinem Departement weitere wichtige Themen – und vor allem bin ich eines von sieben Mitgliedern einer Landesregierung, die von der Gesundheitspolitik über Energie, Wirtschaft bis zur Altersvorsorge über viele wichtige Themen entscheidet. Ein grosser Teil meiner Arbeit ist es, auch zu diesen Fragen meinen Beitrag zu leisten.
Ihr Weg hat Sie von den schwarz-weissen Tasten des Pianos zur Klaviatur der Politik geführt. Musikerinnen und Musiker sind feinfühlige Menschen, in der Politik wird jedoch oft mit harten Bandagen gekämpft. Warum tun Sie sich das eigentlich an?
(lacht) Danke für das Mitgefühl. Machen Sie sich keine Sorgen, ich bin freiwillig und sehr gerne Bundesrätin. Zwischen Musik und Politik gibt es übrigens sehr viele Gemeinsamkeiten – beides sind kreative Tätigkeiten, und bei beiden muss man gut zuhören können, um gut zusammenzuspielen.
Ich mag aber auch die harten Debatten, die es in der Politik gibt. Ich bin viel unterwegs an Veranstaltungen – und am liebsten ist mir immer der Teil, bei dem mir die Bevölkerung Fragen stellen kann, oft auch sehr kritische. Das gehört zu einer direkten Demokratie.
Wie sind Sie denn überhaupt zur politischen Arbeit gekommen?
Ich habe fünf Jahre lang in einem Haus für geschlagene Frauen gearbeitet. Da bin ich Frauen mit Kindern in sehr schwierigen Situationen begegnet – und da ist bei mir sicher ein Bewusstsein dafür entstanden, dass jemand für solche Menschen hinstehen muss. Auch der Konsumentenschutz war für mich stets eine politische Tätigkeit – denn die Konsumenten können mit ihrer Macht das Angebot beeinflussen. Aber sie brauchen in der Politik eine starke Lobby.
Sie haben das katholische Gymnasium Immensee besucht. Dies hat Sie laut eigener Aussage vor allem entwicklungspolitisch geprägt. Haben Sie auch spirituelle Werte mitgenommen?
Meine Lehrer in Immensee waren ja vorwiegend Patres, die in der Entwicklungszusammenarbeit tätig waren und jeweils für einige Jahre ans Gymnasium zurückkamen, um zu unterrichten. Und was sie von diesen Auslandaufenthalten mitbrachten, hat mich sicher beeinflusst – eine gewisse Offenheit, eine Neugier für andere Lebensrealitäten, die ich mir auch als Bundesrätin bewahre: Ich war zum Beispiel in Tunesien, ich habe Menschen in Flüchtlingslagern besucht, ich gehe in Gefängnisse, ich rede mit Verwahrten. Ich möchte all diese Realitäten kennenlernen und mich auch von ihnen herausfordern lassen – auch wenn es mich oft sehr berührt.
Letzte Änderung 09.01.2014