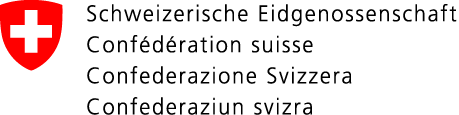Seit 1981 steht die Lohngleichheit in der Verfassung – und doch verdienen Frauen im Schnitt noch immer jährlich rund 7000 Franken weniger als Männer. Was ist los?
Männer verdienen heute im Privatsektor im Schnitt 18 000 Franken mehr pro Jahr als Frauen. Ein Teil dieses Unterschieds lässt sich erklären: Männer sind häufiger in Kaderpositionen oder haben mehr Berufserfahrung. Für einen Teil des Unterschieds gibt es aber keine objektiven Gründe. Derzeit macht dieser ungerechtfertigte Teil 7000 Franken pro Jahr aus. Eine unhaltbare Situation...
... die Sie mit einer Revision des Gleichstellungsgesetzes beseitigen wollen. Dabei können Frauen doch heute schon klagen, wenn sie beim Lohn diskriminiert werden.
Das machen aber nur wenige, weil der Aufwand enorm ist – und weil sich das Verhältnis zum Arbeitgeber durch eine Lohnklage natürlich nicht verbessert.
Der Bundesrat will die Firmen deshalb zu Lohnanalysen zwingen.
Es ist eine pragmatische, unbürokratische Lösung: Private und öffentliche Arbeitgeber mit mehr als 50 Angestellten sollen alle vier Jahre ihre Löhne durchleuchten und die Resultate ihren Mitarbeitern mitteilen. Damit können ungerechtfertigte Lohnunterschiede aufgedeckt und transparent gemacht werden.
So unbürokratisch, wie Sie sagen, klingt das aber nicht. Der Mehraufwand ist doch gewaltig.
Das Wort gewaltig können Sie getrost weglassen. Der Aufwand ist nämlich bescheiden, das haben wir abklären lassen. Mittelfristig wird er für 80 Prozent der Arbeitgeber nicht mehr als einen Tag betragen – und das alle vier Jahre.
Ohne Sanktionen bei Nichteinhaltung der Lohngleichheit bleibt die Vorlage aber zahnlos.
Das glaube ich nicht. Welcher Arbeitgeber will denn vor seine Belegschaft stehen und verkünden, dass seine Mitarbeiterinnen systematisch weniger verdienen als seine Mitarbeiter? Transparenz wirkt. Wir müssen uns von der Idee verabschieden, dass sich nur mit Polizei und Bussen politisch etwas verändern lässt.
Für viele Arbeitgeber tritt der Staat gerade in diesem Fall als Lohnpolizei auf.
Jetzt wird vereinzelt versucht, das Projekt mit Begriffen wie "Lohnpolizei" schlechtzureden. Fakt ist: Es gibt keine Bussen und daher auch keine Polizei. Der Staat greift nicht ein. Die Arbeitgeber entscheiden selber, welche Methode sie anwenden und wer die Analyse überprüft.
Dennoch dürfte im Parlament Ihr Herzensprojekt einen schweren Stand haben. Die vorberatende Ständeratskommission ist nur ganz knapp auf die Vorlage eingetreten.
Die Vorlage ist nicht nur ein Herzensanliegen von mir, sondern auch seit 37 Jahren ein Auftrag in der Verfassung. Aber es war klar, dass es kein Spaziergang wird. Die fehlende Lohngleichheit war ein wichtiger Grund für die Ablehnung der Reform der Altersvorsorge. Der Bundesrat ist überzeugt: Wenn man das Frauenrentenalter an jenes der Männer anpassen will, muss man dafür sorgen, dass Frauen nicht länger systematisch weniger verdienen als Männer.
Warum haben es Frauenanliegen in der Schweiz so schwer?
In der Schweiz sind Frauen erst 1971 politisch mündig geworden. Erst sieben Frauen sassen bisher im Bundesrat. Prozesse dauern. Und weil unser Land zuerst auf Freiwilligkeit setzt, dauert es manchmal noch länger. Es ist richtig, dass man es zuerst auf diesem Weg versucht. Wenn es aber – wie bei der Lohngleichheit – so nicht funktioniert, muss man handeln. Das hat der Bundesrat getan.
Handeln will er auch beim Frauenanteil in der Chefetage.
Der Bundesrat verfolgt auch hier einen pragmatischen Ansatz. Wir zwingen keine Firma, Frauen anzustellen. Tatsache ist aber, dass in den grossen Firmen neun von zehn Geschäftsleitungsmitgliedern Männer sind. Im Verwaltungsrat sind es acht von zehn. Es bewegt sich wenig, weil Männer Männer nachziehen. Der Bundesrat will nun nachhelfen...
... und greift auch hier in die Unternehmensfreiheit ein.
Mit der Einführung von Geschlechter-Richtwerten wählen wir einen sanften Weg. Die Firmen erhalten lange Übergangsfristen, um dafür zu sorgen, dass auf zehn Verwaltungsräte drei Frauen kommen. So schwierig kann das nicht sein. Ausser man findet, Frauen seien für anspruchsvolle Positionen nicht geeignet. Erreicht eine Firma das Ziel nicht, muss sie sich erklären. Staatliche Kontrollen oder Sanktionen gibt es nicht.
Quoten sind das eine, die Frauen müssen aber Führungspositionen auch wollen – und das ist nicht immer der Fall.
Für den Verwaltungsrat finden sich heute gut qualifizierte Frauen, die gerne zur Verfügung stehen. Im Management muss eine Firma die Frauen oft zuerst aufbauen. Doch der Nachwuchs ist vorhanden, zum Beispiel an der ETH: Von all denen, die dort mit einem Doktorat abschliessen, sind heute fast ein Drittel Frauen. Jetzt müssen die Firmen nur ihre Arbeitsbedingungen auch noch so gestalten, dass die Frauen nicht gezwungen werden, sich zwischen Familie und Karriere entscheiden zu müssen.
Im Bundesrat könnten Sie bald die einzige Frau sein. Doris Leuthard wird zurücktreten. Muss auf sie zwingend eine Frau folgen?
Der Bundesrat soll die Bevölkerung abbilden: sprachlich, geografisch, politisch und auch in Bezug auf das Geschlecht. Wenn eine einzige Frau die Hälfte der Bevölkerung abbilden soll, ist offensichtlich etwas nicht in Ordnung.
Geht es auch bei der Burkainitiative um Frauenrechte? Oder mehr um Religion?
Mir zumindest geht es ganz klar um die Frauen. Eine Burka ist eine Zumutung für alle Frauen – auch für jene, die sie selber nicht tragen müssen. Die Initianten hingegen sind nicht bekannt dafür, sich für die Anliegen der Frauen starkzumachen. Ich wünschte mir von dieser Seite einmal einen Vorstoss gegen häusliche Gewalt oder für Lohngleichheit. Grundlegende Probleme wie die Unterdrückung der Frauen lassen sich mit dieser Initiative jedenfalls nicht lösen.
Der Bundesrat will nun Männer bestrafen, wenn sie ihre Frauen zum Burkatragen zwingen. Nötigung steht bereits heute unter Strafe. Das ist doch eine Scheinlösung.
Wir haben schon in der Vergangenheit für spezifische Straftatbestände nachträglich Präzisierungen ins Strafgesetzbuch geschrieben, etwa beim Verbot der Genitalverstümmelung. Damit machen wir deutlich: Hier schauen wir genau hin.
Also doch: Es geht um Symbolpolitik.
In einem Gesetz widerspiegelt sich immer auch ein politischer und gesellschaftlicher Konsens. Wir sagen, was uns wichtig ist und was wir nicht wollen. Aber klar: Der Gegenvorschlag des Bundesrats löst nicht alle Probleme – gerade im Bereich der häuslichen Gewalt.
Dafür kann die SVP in der Asylpolitik stolz auf Sie sein: Dank beschleunigter Verfahren und konsequenter Zurückweisungen ins Erstaufnahmeland verzeichnet die Schweiz weniger Gesuche.
Damit das klar ist: Der Rückgang der Asylgesuche hat nichts mit der SVP zu tun. Tatsächlich haben 2017 rund 18 000 Personen ein Asylgesuch gestellt – das ist der tiefste Wert seit sieben Jahren. Zum Vergleich: 1999 hatten wir 48 000 Gesuche. Tatsache ist: Unser Asylsystem funktioniert. In den letzten Jahren sind Menschen, die keine Asylaussicht haben, immer seltener in die Schweiz gekommen.
Das liegt aber auch an den prekären Internierungslagern in Libyen.
Wenn weniger Migranten übers Mittelmeer kommen, sinken in Europa die Gesuchzahlen. Damit sind die Probleme aber nicht gelöst. Die Zustände in den libyschen Lagern bleiben unhaltbar. Wir helfen dem UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR), besonders gefährdete Personen aus den Lagern zu holen.
Faktisch drängen die europäischen Länder die Migranten zurück und überlassen sie einem gescheiterten Staat. Eine solche Strategie können Sie als Sozialdemokratin doch nicht gutheissen.
Eine solche Strategie würde ich nie gutheissen. Aber so einfach ist es nicht. Ein grosser Teil dieser Migranten sind keine Flüchtlinge im Sinne der Genfer Konventionen. Sie sind auf der Suche nach Arbeit. Wir müssen sie unterstützen, damit sie freiwillig zurückkehren. Wer aber verfolgt ist, kann nicht zurück. Daher haben wir dem UNHCR im Herbst zugesagt, als humanitäre Sofortmassnahme 80 anerkannte Flüchtlinge aufzunehmen.
Sind sie bereits in der Schweiz?
Noch nicht, denn die Lage in Libyen ist schwierig. Das UNHCR kann erst seit November kleine Gruppen von besonders gefährdeten Menschen nach Niger evakuieren. Dort wird abgeklärt, ob sie Flüchtlinge im Sinne der Genfer Konventionen sind. Uns liegen derzeit rund 70 Dossiers vor, die wir prüfen. Es sind mehrheitlich Frauen und Kinder – schwer traumatisierte Menschen. Sie werden wohl im April einreisen.
80 Personen sind eine kleine Zahl angesichts Tausender Inhaftierter.
Solange die Situation derart schwierig bleibt, kann das UNHCR gar nicht mehr Menschen aus Libyen rausholen. Wenn es neue Anfragen gibt, besprechen wir weitere Schritte mit den Kantonen.
Viele Flüchtlinge in Libyen sind Arbeitsmigranten. Wäre eine begrenzte Visavergabe für Arbeitswillige ein Weg, um den Migrationsdruck zu dämpfen?
Die Schweiz hat mit einzelnen Staaten bereits Pilotprojekte lanciert. So dürfen zum Beispiel ausgebildete Tunesier hier ein Praktikum machen. In der Praxis ist das aber schwierig umzusetzen, denn wir brauchen Arbeitgeber, die Stellen anbieten. Zudem können wir die Probleme auf dem afrikanischen Kontinent nicht lösen, indem wir unseren Arbeitsmarkt für alle Arbeitssuchenden aus Afrika öffnen. Was Afrika braucht, sind politische Lösungen und wirtschaftliche Impulse.
Eritrea ist seit Jahren der wichtigste Herkunftsstaat in der Asylstatistik. Hand aufs Herz, Frau Bundesrätin: Der Schweiz fehlt eine Strategie im Umgang mit dem Land.
Die Gesuche sind massiv zurückgegangen. 2015 stellten 10 000 Eritreer ein Asylgesuch, letztes Jahr waren es 3300 Personen – zwei Drittel weniger innerhalb zweier Jahre. Die Strategie des Bundesrats ist klar: Für eine Zusammenarbeit mit Eritrea braucht es den politischen Dialog. Das Aussendepartement bemüht sich seit längerem darum, letztes Jahr reisten mehrere Schweizer Delegationen ins Land; es gibt diesen Dialog also. Ich selber habe den Präsidentenberater und den Aussenminister getroffen.
Während der Präsident das Gespräch verweigert, geht der Massenexodus täglich weiter. Reicht es, wenn die Schweiz einfach auf dessen Kooperationswillen wartet?
Ihre Annahme ist falsch. Die Schweiz hat nicht gewartet, sondern zusammen mit Deutschland, Schweden und Norwegen das Gespräch mit Eritrea gesucht. Zudem bemühen wir uns, dass Eritrea abgewiesene Asylsuchende zurücknimmt. Im Gegenzug sind wir bereit, das Land zu unterstützen.
Multimedia
Video: Bundesrätin Sommaruga über Frauen in der Arbeitswelt von morgen
Letzte Änderung 22.01.2018