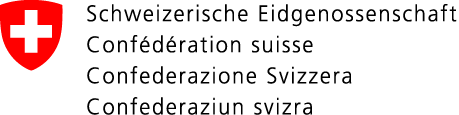Humanitäre Tradition gehört zu unserer Identität
Bern, 01.08.2014 - 1. August-Rede 2014 in Laupen. Es gilt das gesprochene Wort.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir befinden uns heute Abend an einem historischen Ort. Das Schloss Laupen erinnert uns an kriegerische Auseinandersetzungen, aber auch an Verbündete. Sie sind zu Hilfe geeilt, als Laupen in Not war.
Menschen in Not unterstützen, das ist eine der wichtigsten Traditionen unseres Landes. Und an unsere Traditionen erinnern wir uns am Nationalfeiertag. Wir dürfen stolz darauf sein, dass das Internationale Komitee vom Roten Kreuz in unserem Land gegründet wurde, und dass die wichtigsten internationalen Konventionen zum Schutz der Flüchtlinge bei uns in der Schweiz deponiert sind.
Humanitäre Tradition gehört zu unserer Identität
Die humanitäre Tradition gehört zur Identität unseres Landes; genauso wie die Neutralität und die Unabhängigkeit. Sie wird jetzt, wo Kriegsflüchtlinge in unser Land kommen, ganz besonders auf die Probe gestellt.
Die allermeisten Kriegsflüchtlinge gelangen aber gar nicht bis zu uns. Sie suchen in ihren Nachbarländern Schutz. Ich möchte Euch einladen, einen Moment mit mir nach Jordanien zu kommen, wo ich vor kurzem auf Arbeitsreise war.
Die Autofahrt von Jordaniens Hauptstadt Amman zum Flüchtlingslager an der syrischen Grenze dauert knapp zwei Stunden. Nichts als Steine und Sand, ab und zu ein Haus und dann, mitten in der Wüste, Zelte soweit das Auge reicht. Das Flüchtlingslager Za'atari - wenige Kilometer von der syrischen Grenze entfernt - ist fast so gross wie die Stadt Winterthur. 90 000 syrische Flüchtlinge leben dort. Über die Hälfte, fast 50 000, sind Kinder.
Der Leiter des Flüchtlingslagers sagte mir, er arbeite seit über 25 Jahren mit Flüchtlingen, aber so viele verstörte und traumatisierte Kinder habe er noch nie gesehen.
Ängste auch im Flüchtlingslager
Ich stieg mit beklemmenden Gefühlen aus dem Auto. Die fast 40 Grad machten mir zu schaffen; noch viel mehr zu schaffen machte mir aber die Vorstellung, unter welch dramatischen Umständen viele dieser Menschen ihr Zuhause verlassen mussten. Drei Wochen seien sie auf der Flucht gewesen, erzählte mir eine Mutter. Sie hätten kaum zu essen gehabt und die Kinder seien fast verdurstet. Jetzt sind sie seit über einem Jahr in diesem Lager und warten. Nachts sehen sie auf der anderen Seite der Grenze die Leuchtkörper der Raketen, hören den Lärm der Schüsse und denken an ihre Angehörigen: Väter, Eltern, Geschwister, die dort geblieben sind, weil sie zu alt oder zu krank waren für die Flucht, oder weil sie ihre Heimat nicht kampflos aufgeben wollten. Nacht für Nacht kommen die Ängste zurück.
Gegen Abend traf ein Bus ein. Er brachte mehr als hundert Flüchtlinge, die direkt an der Grenze aufgegriffen worden waren. Vorwiegend Frauen mit Kindern und ältere Menschen. Erschöpft stiegen sie aus; mit dabei hatten sie ein in Tuch eingewickeltes, grosses Bündel - alles, was ihnen geblieben war. Ich habe versucht, mir einen Moment lang vorzustellen, dass ich in ihrer Lage wäre; ich habe es nicht geschafft.
Für die Menschen, die sich täglich um die Flüchtlinge kümmern, habe ich den grössten Respekt. Sie geben ihnen Schutz und Sicherheit. Vor allem aber versuchen sie auch, ihnen die Würde zurückzugeben, indem sie ihnen von gleich zu gleich und nicht als Bedürftigen und Abhängigen begegnen.
Jordanien nicht allein lassen
Jordanien ist ein Land mit weniger Einwohnern als die Schweiz und hat in den letzten drei Jahren über 600 000 Flüchtlinge aus Syrien aufgenommen. Die meisten Flüchtlinge leben nicht in Lagern, sondern in den Dörfern und Städten. Damit ihre Kinder zur Schule gehen können, gibt es für die jordanischen Kinder nur noch am Vormittag Unterricht. Am Nachmittag sind die syrischen Kinder dran. Der Wassermangel in Jordanien ist mit den vielen Flüchtlingen noch prekärer geworden. Die fehlenden Medikamente in den Spitälern müssen mit den syrischen Flüchtlingen geteilt werden.
Die internationale Gemeinschaft unterstützt Jordanien, wo sie kann. Auch die Schweiz hat sich finanziell beteiligt. Doch die jordanischen Behörden befürchten, dass man die enorme Solidarität ihrer Bevölkerung irgendwann für selbstverständlich hält und Jordanien vergisst, weil die internationale Hilfe an einem anderen Ort gebraucht wird. Es ist klar: Jordanien schafft das nicht alleine, ebenso wenig wie der Libanon und die Türkei. Denn allein in dieser Region gibt es fast 3 Millionen syrische Flüchtlinge.
Die wenigsten kommen nach Europa
Und wer nicht in der Region bleibt, flieht weiter Richtung Europa. Viele suchen den Weg übers Mittelmeer. Sie warten in Libyen auf die Überfahrt. Man geht davon aus, dass sich zur Zeit rund 100 000 Syrerinnen und Syrer in Libyen aufhalten. Dort sind sie oft in geschlossenen, von Rebellen bewachten Lagern untergebracht und nicht selten schweren Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt.
Der Weg übers Mittelmeer ist extrem gefährlich. Tausende von Menschen sind im Mittelmeer ertrunken. Italien hat nach dem Bootsdrama im letzten Herbst eine eigene Rettungsaktion gestartet. Bis Mitte Jahr hat Italien fast 60 000 Menschen im Mittelmeer gerettet und an Land gebracht. Italien verdient für diesen Akt der Menschlichkeit unsere Anerkennung.
In den letzten Wochen landeten jeden Tag zwischen 1000 und 2000 Menschen an Italiens Küsten. Seien wir ehrlich: Auch unser Asylwesen würde bei solchen Zahlen an Grenzen stossen.
Tun wir, was möglich ist?
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich habe Euch von den Flüchtlingen aus Syrien erzählt. Ihre Situation beschäftigt mich. Ich kann die vielen Kinder, die Frauen und Männer nicht vergessen. Immer wieder frage ich mich: Was verlangt diese Situation von uns, von unserem Land mit seiner langen humanitären Tradition?
Ich bin froh, dass der Bundesrat entschieden hat, die Tradition der Kontingentsflüchtlinge wieder aufzunehmen, und dass unser Land - als einziges in Europa - über 3000 Syrer/-innen mit Angehörigen in der Schweiz die erleichterte Einreise ermöglicht hat. Und trotzdem bleibt die Frage: Was werden unsere Kinder und Grosskinder sagen, wenn sie später auf diese Jahre zurückschauen? Haben wir getan, was nötig war? Haben wir getan, was möglich war?
International und europaweit gefordert...
Natürlich wissen wir, dass die Schweiz diese grosse Verantwortung nicht allein tragen kann. Im Verbund mit anderen Staaten müssen wir dafür sorgen, dass die Nachbarländer der Krisenregionen verstärkt unterstützt werden; denn sie tragen die weitaus grösste Last.
Vermehrte Solidarität braucht es aber auch innerhalb Europas. Wir dürfen die südeuropäischen Länder nicht allein lassen. Alle europäischen Staaten - und dazu gehört auch die Schweiz - tragen hier eine gemeinsame Verantwortung
... aber auch im Inland
Gefordert sind wir schliesslich auch im Inland. Es kommen zurzeit wieder mehr Asylsuchende in die Schweiz. Für sie brauchen wir Unterkünfte und eine aufnahmebereite Bevölkerung.
Das sehen nicht alle so: Die Forderung, das Asylrecht in unserem Land faktisch abzuschaffen, ist beschämend; vor allem aber verstösst diese Forderung gegen eine der wichtigsten Traditionen in unserem Land.
Es ist gut zu wissen, dass in vielen Städten und Gemeinden die Flüchtlinge offen und herzlich aufgenommen werden.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir können stolz sein auf die Solidarität und die humanitäre Tradition, die unser Land auszeichnen.
Die humanitäre Tradition ist kein abstrakter Begriff, sondern sie bedeutet, dass wir den Menschen, die in Not sind, helfen.
Und ich finde, dass der 1. August sehr geeignet ist, uns daran zu erinnern.
Adresse für Rückfragen
Kommunikationsdienst EJPD, T +41 58 462 18 18
Herausgeber
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
http://www.ejpd.admin.ch
Letzte Änderung 19.01.2023