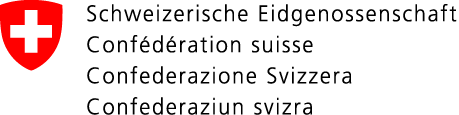Keine ausdrückliche Regelung der organisierten Suizidhilfe
Bern, 29.06.2011 - An der Medienkonferenz des Bundesrates ging Bundesrätin Simonetta Sommaruga auf die Ergebnisse der Vernehmlassung zu einer spezifischen Regelung der Sterbehilfe ein. Sie erörterte ausserdem die Vorbehalte, die gegen die vom Bundesrat favorisierte Variante geäussert wurden, und legte die Gründe dar, die den Bundesrat zum Verzicht auf eine ausdrückliche Regelung der organisierten Suizidhilfe bewogen. Es gilt das gesprochene Wort.
Sehr geehrte Damen und Herren
Das Thema Suizidhilfe ist ein äusserst wichtiges - aber auch ein sehr sensibles - Thema, das viele Menschen in diesem Land beschäftigt. Es geht um die Frage, wie jemand das Ende seines Lebens gestaltet, es geht um Fragen der Verantwortung, es geht um ethische Fragen und um religiöse Vorstellungen.
In den zahlreichen Gesprächen, die ich in den vergangenen Monaten geführt habe, habe ich festgestellt, dass das Thema Suizid und Suizidhilfe bei den meisten Menschen mit Erfahrungen aus dem eigenen Umfeld oder mit ganz persönlichen Vorstellungen verbunden ist. Es ist deshalb verständlich, dass die Diskussionen zu den Themen Suizid und Suizidhilfe oft sehr heftig und leidenschaftlich geführt werden. Schliesslich ist die Betroffenheit gross und die Fragen von Leben und Tod sind bei uns allen mit starken Gefühlen verbunden.
Umso wichtiger ist es, dass die Politik, wenn sie sich zu diesem Thema äussert, dies mit Sorgfalt und mit Respekt gegenüber den unterschiedlichen Vorstellungen und Erwartungen tut.
Der Bundesrat hat sich in den vergangenen Jahren intensiv mit dem Thema der Sterbe- und Suizidhilfe befasst. In seinem Bericht aus dem Jahr 2006 gelangte er zum Schluss, dass man mit dem geltenden Recht Missbräuche bei allen Formen der Sterbehilfe verhindern oder ahnden kann; dies allerdings unter der Voraussetzung, dass man das geltende Recht konsequent anwendet und durchsetzt.
Im Jahr 2007 erstellte der Bundesrat einen Ergänzungsbericht. Darin stellte er fest, dass die Verschreibung und die Abgabe der tödlichen Substanz Natrium-Pentobarbital (NAP) ausreichend geregelt sind, und dass es keine strengeren Vorschriften im Betäubungsmittelrecht braucht.
Und trotz dieser Erkenntnisse ist die öffentliche Diskussion zum Thema Sterbehilfe und Suizidhilfe in den letzten Jahren kontrovers geblieben. Der Bundesrat beschloss deshalb im Jahr 2008, dass er spezifische Regelungen für den Bereich der organisierten Suizidhilfe prüfen will.
Und er hat im Oktober 2009 zwei Vorschläge für eine Änderung des Strafrechts in die Vernehmlassung geschickt. Variante 1 sah für Mitarbeitende und Verantwortliche von Suizidhilfeorganisationen gewisse Sorgfaltspflichten vor. Variante 2 hätte ein Verbot der organisierten Suizidhilfe bedeutet. Der Bundesrat sprach sich für Variante 1 aus.
Im September 2010 hat der Bundesrat das Vernehmlassungsergebnis zur Kenntnis genommen. Eine deutliche Mehrheit der Kantone, Parteien und interessierten Organisationen brachte zum Ausdruck, dass sie einen gesetzgeberischen Handlungsbedarf sehen. Gleichzeitig bestand aber überhaupt kein Konsens darüber, wie die organisierte Suizidhilfe geregelt werden sollte.
Verschiedene Vernehmlassungsteilnehmer sprachen sich für ein Aufsichtsgesetz aus. Andere wiederum forderten den Bundesrat auf, die Suizidprävention und Palliative Care zu fördern. Auch das Verbot der organisierten Suizidhilfe war umstritten. Es wurde von einer klaren Mehrheit als unzulässige Beschränkung des Selbstbestimmungsrechts verworfen.
Der Bundesrat hat mein Departement letzten Herbst beauftragt, die Variante 1, also die Festlegung von Sorgfaltspflichten, im Lichte der Vernehmlassungsergebnisse zu überarbeiten.
Dabei sollten aber auch die drei folgenden Vorbehalte gegen die Variante 1 berücksichtigt werden:
Vorbehalt Nummer 1 war, dass drei unabhängige Ärzte in den Suizidhilfeprozess mit einbezogen werden sollten. Das wurde als extrem belastend, als nicht praktikabel und als Schikane empfunden.
Vorbehalt Nummer 2 war, dass die organisierte Suizidhilfe nur noch bei todkranken Patienten erlaubt wäre. Diese Einschränkung stiess auf heftige Ablehnung. Sie wurde als diskriminierend und als Verletzung des Selbstbestimmungsrechts kritisiert.
Vorbehalt Nummer 3 schliesslich galt der Bestimmung, wonach die Suizidhelfer keine Gegenleistung annehmen dürfen, welche die Kosten für die geleistete Suizidhilfe übersteigen. Auch diese Bestimmung wurde in der Vernehmlassung äusserst kontrovers aufgenommen. Während die einen befürchteten, dass dadurch die Qualität der Suizidhilfe beeinträchtigt wird, forderten die anderen, dass Suizidhelfer absolut unentgeltlich handeln müssten.
In Kenntnis all dieser Vorbehalte überarbeitete das EJPD die Artikel im Strafgesetzbuch und im Militärstrafgesetz. Sie finden auf Seite 33 des Berichts eine überarbeitete Bestimmung, die dieser Kritik Rechnung zu tragen versucht. Gemäss dieser Bestimmung würde nicht mehr auf den Gesundheitszustand der suizidwilligen Person abgestellt. Vielmehr würden Massnahmen im Zentrum stehen, die sicherstellen, dass eine Person urteilsfähig ist und über ihre Krankheit sowie über Behandlungsmöglichkeiten aufgeklärt wurde.
Ausserdem wäre nur ein einziger Arzt dafür verantwortlich, die Urteilsfähigkeit der suizidwilligen Person zu prüfen, sie vollständig aufzuklären und ihr allenfalls das Betäubungsmittel Natrium-Pentobarbital (NAP) zu verschreiben.
Schliesslich müssten die Suizidhelfer gemäss dieser überarbeiteten Bestimmung unentgeltlich tätig sein.
Die überarbeitete Bestimmung berücksichtigt die Kritik, wie sie in der Vernehmlassung geäussert wurde. Allerdings würde sie lediglich noch das konkretisieren, was bereits heute geltendes Recht ist.
Schon heute - und das ist vermutlich vielen Menschen nicht genügend bekannt - muss nämlich ein Arzt die Urteilsfähigkeit einer suizidwilligen Person prüfen. Schon heute muss er mit dem Patienten Alternativen erörtern. Und schon heute muss er selber die tödliche Substanz verschreiben.
Die ärztlichen Standesregeln halten weiter fest, dass der Suizidwunsch wohlerwogen, ohne äusseren Druck entstanden und dauerhaft sein muss, und dass dies von einer Drittperson überprüft wird.
Schon heute macht zudem das Strafrecht klar, dass sich strafbar macht, wer aus selbstsüchtigen Beweggründen jemanden zum Selbstmord verleitet oder ihm dazu Hilfe leistet. Profitorientiertes Arbeiten in der Sterbehilfe ist also schon heute strafbar. Das gilt für alle, die mit der betreffenden Person kurz vor ihrem Suizid Kontakt haben: Also Suizidhelfer, verschreibende Ärzte, Apotheker, aber auch die Verantwortlichen der Suizidhilfeorganisation.
Eine Änderung der bestehenden Gesetzesbestimmung würde zum einen also lediglich die heutige Rechtslage konkretisieren. Zum andern würde sie nach Ansicht des Bundesrats aber auch klare Nachteile mit sich bringen.
Wenn man den Suizidhilfeorganisationen nämlich explizit staatliche Kontrollen auferlegt - wie das die überarbeitete Gesetzesbestimmung vorsieht -, würde man diese Organisationen gleichzeitig auch staatlich legitimieren, ihnen sozusagen ein staatliches Gütesiegel verleihen. Der Bundesrat befürchtet, dass eine solche Legitimation einen zusätzlichen Anreiz für Personen im In- und Ausland schaffen würde, die Dienste dieser Organisationen in Anspruch zu nehmen.
Die überarbeitete Bestimmung würde ausserdem in Ärztekreisen nur auf geringe Akzeptanz stossen. Der Berufsverband hatte sich in der Vernehmlassung dagegen gewehrt, dass die Suizidhilfe zu einer gesetzlich geregelten ärztlichen Tätigkeit werden soll.
Aus all diesen Überlegungen hat der Bundesrat heute entschieden, auf einen neuen Gesetzesentwurf zu verzichten. Dieser Verzicht auf ein neues Gesetz oder eine neue gesetzliche Bestimmung ist jedoch kein Verzicht auf staatliche Kontrolle in diesem doch sehr sensiblen Bereich. Denn das heutige Recht kennt ja bereits eine Bestimmung gegen die Verleitung und die Beihilfe zum Selbstmord.
Mit dem heutigen Entscheid bringt der Bundesrat zum einen also zum Ausdruck, dass Missbräuche bereits mit dem heute geltenden Recht geahndet werden können. Und der Bundesrat erwartet, dass dies auch getan wird. Zum andern bringt der Bundesrat damit aber auch zum Ausdruck, dass er das Recht auf Selbstbestimmung am Lebensende stärken will.
Zur Selbstbestimmung am Lebensende gehört, dass verschiedene Betreuungsangebote vorhanden sind, und dass unheilbar Kranke und Sterbende diese Angebote kennen, zum Beispiel die Palliative Care. Denn: Nur wer die bestehenden Angebote und Möglichkeiten kennt, kann wirklich frei entscheiden.
Ein wichtiges Anliegen bleibt auch die Verhinderung von Suiziden. Der Bundesrat will deshalb hier ansetzen: bei der Förderung von Palliative Care und Suizidprävention. In beiden Bereichen ist der Bund heute bereits tätig - unter der Federführung des Eidgenössischen Departements des Innern und gemeinsam mit den Kantonen, die für die Gesundheitsversorgung zuständig sind. Es gibt eine „Nationale Strategie Palliative Care", in deren Rahmen wichtige Fragen zur Finanzierung, Versorgung, Bildung, Sensibilisierung und Forschung aktiv angegangen werden. Und es gibt ein „Bündnis gegen Depression", dem sich bereits elf Kantone angeschlossen haben.
Das EDI wird nun im Auftrag des Bundesrats die Weiterführung der Strategie prüfen und die Erweiterung des Bündnisses weiterverfolgen. Zudem hat der Bundesrat das EDI beauftragt, zu prüfen, wie sich Erwerbsleben und die Pflege von unheilbar kranken respektive sterbenden Angehörigen besser miteinander vereinbaren lassen. Eine interdepartementale Arbeitsgruppe wird dazu bis Ende 2014 Massnahmen vorschlagen.
Sehr geehrte Damen und Herren, es ist dem Bundesrat ein wichtiges Anliegen, die Selbstbestimmung auch am Lebensende zu stärken. Dies entspricht einem Bedürfnis der Gesellschaft, das in den kommenden Jahren in Folge der Alterung der Bevölkerung noch wachsen dürfte.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Adresse für Rückfragen
Kommunikationsdienst EJPD, T +41 58 462 18 18
Herausgeber
Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
http://www.ejpd.admin.ch
Letzte Änderung 19.01.2023